Mein Sydney
Australiens Top-City zwischen Untergrund und Luxus
Einige haben schon mal das Sydney Opera House gesehen, aber noch nicht auf dessen Bühne gestanden. Viele knipsen die Harbour Bridge, die meisten klettern aber nicht drauf. Etliche träumen von einer Nacht im Park Hyatt mit Hafenblick, aber für die meisten bleibt es ein Traum. Viele haben von Sydneys Rotlichtviertel gehört, ahnen aber nichts von Mord und Totschlag dort. Ich will mehr wissen und erleben, schaue mir Sydney mal von unten und oben, von hinten und vorne an.
Sydney von unten
„Never let the truth get in the way of a good story“, lautet Kathryn Bendalls Motto – die Wahrheit sollte einer guten Geschichte niemals im Wege stehen. Und recht hat sie, vor allem, wenn es um den berüchtigten Stadtteil Kings Cross geht. Kathryn Bendall, eigentlich Rentnerin, wirkt mit ihrem peppigen Kurzhaarschnitt und dem lippenstiftroten Lächeln so schräg wie der Stadtteil, durch den sie Besucher für Urban Adventures führt. „Im Grunde ist Sydney die Stadt der Kriminellen“, klärt Kathryn jeden auf, der noch nie die Nase ins australische Geschichtsbuch gesteckt hat – 1788 gründeten die Briten nämlich eine Sträflingskolonie im heutigen Sydney.


Die Sonne ist längst untergegangen, wir stehen an der Kreuzung von Darlinghurst Road und Victoria Street. Ein paar Autos fahren, vereinzelte Leute eilen vorbei. Die Häuser der Nebenstraßen sind von der Sorte, die man in einen Vorort pflanzt und mit dem Versprechen auf ewiges Familienglück vertickt. Dabei stehen wir mitten im Rotlichtviertel. Oder zumindest boomte dort lange das Geschäft mit der ‚schönsten Nebensache der Welt‘. Heute bringen nur noch die Glühbirnen hinter den in Pink und Rot blinkenden Frauenfiguren Höchstleistung, manch rostige Schnörkelschrift lässt kaum noch die Buchstaben ‚Stripclub‘ ausmachen. „Nach den Lockout Laws 2014 haben viele Clubs und Bars geschlossen, es kommen 80 Prozent weniger Leute“, erklärt Kathryn, wieso auch an einem Freitagabend Friedhofsstimmung herrscht. Das Aussperrungsgesetz besagt, dass nach 1.30 Uhr niemand mehr in eine Bar, wo Alkohol verkauft wird, reindarf. Alkohol wird nur bis drei Uhr ausgeschenkt, in Geschäften darf er schon ab 22 Uhr nicht mehr über den Tresen gehen. Warum? „2012 und 2013 gab es Todesfälle – zwei junge Männer wurden in Kings Cross getötet. Natürlich vor 22 Uhr!“ Kathryn glaubt bei dem Gesetz nicht an den Schutz ihrer Mitbürger. Sie glaubt, dass der Grundstücksverkauf mal wieder in Schwung gebracht werden soll.
So lammfromm Kings Cross heute wirkt, so heiß war es vor gar nicht langer Zeit. „Wie entsteht Kriminalität? Wenn man jemandem sagt, er könne etwas nicht haben“, weiß Kathryn. „Schon seit den 1840ern ist die australische Marine in Kings Cross angesiedelt, deswegen entwickelte sich das Rotlichtmilieu.“ Bis 1979 sei Prostitution in der Provinz New South Wales jedoch illegal gewesen. „Einer, der alles, was nicht erlaubt war, hervorragend beherrschte, war Abe Saffron.“ Bis dato habe ich nicht von dem Mann gehört, der Down under als ‚Mr. Sin‘ oder ‚Mr. Big of Australian crime‘ gehandelt wird. Dabei sollte Saffron, der ab den 40ern etwa 40 Bars, Clubs und Sex Shops kaufte, eigentlich in einem Zug mit dem Sydney Opernhaus und der Harbour Bridge genannt werden. „Er war ein Charmeur, der sogar Politiker und Gouverneure in seine Clubs einlud, damit sie ihre sexuellen Fantasien auslebten. Natürlich wussten sie nichts von den zweiseitigen Spiegeln.“ Kathryn lacht.
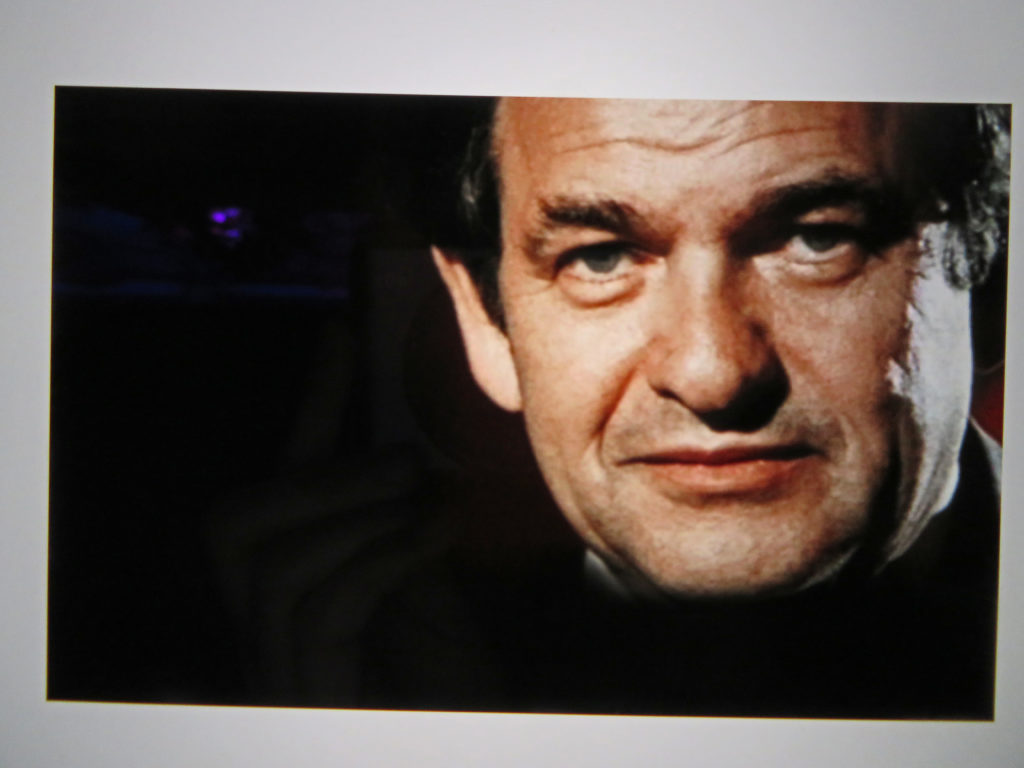

„In den 70ern wollte Saffron in der Victoria Street ein Bauprojekt starten, Apartment-Hochhäuser. Hunderte von Menschen wurden innerhalb eines Monats illegal aus ihren Häusern geworfen.“ Wir bleiben vor Victoria Street 202 stehen, wo eine Tafel im Boden an Juanita Nielsen erinnert. „Juanita arbeitete für eine Zeitung und rebellierte gegen diese Maßnahmen. Man nimmt an, dass sie die Szenen fotografierte und darauf auch Polizisten zu sehen waren, die tatenlos zusahen. Alle von Abe gekauft.“ Bis Juanita im Juli 1975 plötzlich verschwand. „Es ist die längste Ermittlung unserer Geschichte, ihre Leiche wurde bis heute nicht gefunden.“ Aber Kathryn hat eine Theorie: „Da hinten stehen die scheußlichen Hochhäuser, die gebaut wurden, meine Tochter wohnt auch darin. Ich sage ihr immer, sie hat bestimmt Juanita Nielsens Leiche im Keller.“ Jedoch habe man Abe nie nachweisen können, dass er in das Verschwinden verwickelt gewesen sei.


Schräg gegenüber outet sich ein lila angeleuchtetes Haus als ‚The Golden Apple‘, einst das berühmteste Freudenhaus von Kings Cross. Während dort auch heute noch Körper zu Geld gemacht werden, schlafen im ehemaligen Venus Room, Abes exklusivstem Club, nur noch Backpacker. Selbst vom Drogenslum, der Kings Cross in den 1960ern gewesen sein soll, ist nichts mehr zu sehen. „In den 1960ern kamen viele amerikanische Soldaten aus dem Vietnamkrieg her, und sie brachten Drogen mit, Heroin. Abe machte ein Riesengeschäft daraus, bald waren die Straßen übersät mit Nadeln und Abhängigen, zum Teil noch Kinder.“ Erst dank des methodistischen Pfarrers Ted Noffs, der eine Stiftung und Kirche zur Hilfe der Drogensüchtigen gründete, sei wieder etwas Ordnung eingekehrt. „Die Kirche hatte kein Kruzifix, dafür aber ein Herz mit der Inschrift ‚Love over hate‘“, berichtet Kathryn. Und heute? Ist das Drogenproblem gelöst? Kathryn bleibt vor einem Gebäude in der Nähe der Kings Cross U-Bahn-Station mit einer mittig undurchsichtigen Scheibe stehen. „Das ist ein Fixerraum, wo Süchtige unter Aufsicht von Pflegepersonal und Ärzten fixen dürfen. Man darf eine gewisse Menge Drogen mit sich rumtragen und hier spritzen.“ Und was sagen die Anwohner zu den Fixer-Nachbarn? „Die sind froh, dass es nun keine Probleme mehr auf der Straße gibt!“


Kathryn lädt noch auf ein Bier ein. Ins Puff. Besser gesagt ins ehemalig größte Bordell von New South Wales, das Nevada. Heute heißt es World Bar und ist eine ganz manierliche Kneipe mit schöner Terrasse. In einer dieser Straßen mit den gemütlichen Vorstadthäuschen. Alles so unspektakulär wie der Tod des Gehilfen vom großen Gangster Abe, der laut Kathryn an der Vogelgrippe starb, nachdem ihn ein Papagei gebissen hatte. Ob das wahr ist? Die Frage bleibt offen, aber eine gute Story ist es allemal.


Sydney von oben
Nach meinem Ausflug in die Unterwelt wird es Zeit, mir die City mal bei Hellem und von oben anzusehen. Nachdem mich ein Ausflug auf 251 Meter Höhe zur Aussichtsplattform des Sydney Tower gar nicht überzeugt hat (zu viele Wolkenkratzer spielen Photobombing vor Hafen und Opernhaus), muss etwas Besseres her. Und wo ist der Blick dramatischer als von der weltberühmten, 1932 eröffneten Sydney Harbour Brücke? Der umfangreichsten – wenn auch nicht längsten – Stahlbogenbrücke der Welt. Dem Symbol Australiens. Auf das man tatsächlich raufkraxeln kann.


Bridge Climb nennt sich das Unterfangen, die 134 Brückenmeter über Sydneys Hafen zu erklimmen. Klettern darf man seit 1998, seitdem haben es über 3,5 Millionen Menschen probiert und sogar 26 Pärchen oben geheiratet. Nicht etwa nur VIPs, jeder darf mit von der Partie sein, solange er älter als acht ist, gesund und fit genug, das Stahlungetüm zu erobern. Zugegeben, ganz billig ist der Spaß von etwa 300 AUD nicht, aber was soll’s – schließlich macht man nicht jeden Tag den „Climb of a lifetime“, wie er sich nennt. Ich stehe vor der Qual der Wahl zwischen dem etwa dreieinhalbstündigen vollen Climb und dem Express Climb von nur zwei Stunden und 15 Minuten. Aus Zeitmangel wird es der Express – die beste Entscheidung, wie ich bald erfahre. Doch bevor es losgeht, wird die Gruppe genauer geprüft als ein alter PKW beim TÜV.


Jeder füllt einen Bogen mit persönlichen Informationen aus, darunter Notkontakte, dann wird in ein Röhrchen geblasen. Wer mehr als null Promille aufweist, fliegt raus. Die Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit, mit der jeder für den Bridge Climb verpackt und vorbereitet wird, erinnert an deutsche Steuerfahnder. Jeder Handgriff sitzt und die Reihenfolge, in der wir die nicht gerade figurschmeichelnden Anzüge überstreifen, Sicherheitsgurte anlegen, Stofftaschentuch am Arm und Sonnenbrille sowie Baseballmütze am Hals befestigt bekommen, ist streng vorgegeben. Nichts, was nicht fest am Körper sitzt, darf mit auf die Brücke. Nicht mal ein Papiertaschentuch, von Schmuck, Handy und Fotoapparat ganz zu schweigen. Fotos, die der Guide schießt, darf man später kaufen.

Endlich geht es los. Als Erstes wird jeder für die nächsten Stunden mit der Brücke vereint – der Haken am Hüftgurt verbindet sich mit einem Spezialseil am Brückenrand und kann fortan daran entlang gezogen werden. Hier stirbt auch der letzte Traum von einem spektakulären Selbstmord, wie man sie beispielsweise am Grand Canyon nachlesen kann (dort soll sich jemand beim Hubschrauberrundflug aus der Kabine gestürzt haben!). Da man gut zwei Stunden denselben Hintern vor sich sehen wird, sucht man sicher besser einen attraktiven aus.
Im Gegensatz zum längeren Climb führt der Express quer durch die Brücke, über Laufstege aus Stahl, an denen jedes Eckchen und jede Kante, an der man sich stoßen könnte, wattiert sind. Beulen am Kopf und gekratzte Ellenbogen Fehlanzeige, alles ist mit absoluter Perfektion durchdacht und vorbereitet. Wir klettern langsam vom inneren Bogen auf den äußeren, durch Stahltüren, die hinter uns schwer ins Schloss fallen und nur vom Guide geöffnet werden können. Die Gitter am Boden lassen den Ozean in knapp 100 Meter Tiefe durchblitzen, rechts strahlt das Opernhaus in der Sonne. Und dann flitzen genau unter uns Autos über die achtspurige Brückenautobahn. Ein Gefühl wie in einem surrealen 3D-Streifen. Mit Höhenangst würde ich das Spiel nicht mitmachen, und für schwache Nerven ist wahrscheinlich selbst das Drahtseil, mit dem wir an die Brücke gekettet sind, nicht stark genug. Nur die Arbeiter, dank derer wir nun auf der Brücke herumspazieren, die mussten für ein Pfund pro Tag über die Planken balancieren. Da grenzt es an ein Wunder, dass während der Konstruktion nur 16 Männer ihr Leben gelassen haben, davon lediglich zwei durch einen Sturz von der Brücke.







Endlich ist es soweit. Nicht der ‚Stairway to heaven‘, dafür aber die Treppe zum Brückengipfel öffnet sich. Aus den Tiefen des Stahlmonsters treten wir ins Licht und stehen unter ihr – der riesigen, australischen Flagge, die den höchsten Brückenpunkt markiert. Das Opernhaus und die Wolkenkratzer der Neustadt sind plötzlich nicht mehr imposant, sondern verstreut umherliegendes Spielzeug. Das Glück weht mir so beständig um die Nase wie die Brise, während einer nach dem anderen die Arme in die Luft werfen und ein kurzes Video für die Lieben daheim aufsprechen darf.






So oft habe ich diese Brücke gesehen, zu Hause auf dem Bildschirm, meistens, wenn über ihr eins der ersten großen Silvesterfeuerwerke der Welt in die Luft ging. Jetzt stehe ich nicht vor, sondern auf ihr. Ich weiß nicht, ob dies wirklich mein ‚Climb of a lifetime‘ sein wird. Aber ich sortiere das Erlebnis sorgfältig ein in die Schatzkiste all derer, die ich mit dem großen Gefühl von Freiheit und Dankbarkeit, dabei gewesen zu sein, einordne.


Sydney von hinten
Wieder eins dieser Wahrzeichen, das Wahrzeichen von Sydney, wieder ein berühmtes Gebäude, das angeblich vier Milliarden Menschen auf Anhieb erkennen würden. UNESCO-Welterbe seit 2007. Das Sydney Opernhaus. So extravagant auffällig wie ein Nackter in der U-Bahn, nur (allgemein gesprochen) formvollendeter. In fünf Sälen wird dem teuer zahlenden Publikum täglich all das präsentiert, was bis zur Perfektion gepaukt wurde, alles, was Ohren und Augen die Misere der Welt kurz vergessen lässt. Das, was Otto Normaltourist vom Sydney Opernhaus zu sehen bekommt, erinnert mich an eine perfekt geschminkte und gestylte Frau, die morgens in Kostümchen und Heels aus dem Haus trippelt. Doch ich möchte die Frau sehen, die mit zerzaustem Haar, zerknittertem Gesicht, frischen Pickeln und verkrusteten Kajalresten am Lid aufwacht. Also mache ich bei einer Opernhaus-Backstagetour mit.



Ich kann mir keinen besseren Guide vorstellen als den bärtigen Alex, der den Besuchern gleich mal die Hoffnung raubt, auch hinter der Bühne Glanz und Gloria vorzufinden. Es geht durch eine Halle mit grauem Fußboden, Gabelstaplern und vielen Kisten, die ans Lagerhaus beim Baumarkt erinnert. Nein, das hier hat Königin Elizabeth II. bestimmt nicht gesehen, als sie das Opernhaus 1973 einweihte. Auch nicht den Mega-Aufzug, der das schwere Bühnenmaterial für die Stücke aus drei Stockwerken Tiefe nach oben zerrt. Oder die gigantischen, herumliegenden Eier, aus denen im aktuellen Stück ‚Murphy‘ Tänzer hervorspringen. „Für jedes Stück bringen die Darsteller ihr eigenes Material mit, das wir hier für sie aufbewahren“, erklärt Alex. Und er hat recht, so richtig sexy sieht es dort nirgends aus. Eher noch wüster als in meiner Abstellkammer daheim.

Im Gegensatz zu dieser gibt es im Opernhaus aber 12 Falltüren, manche groß genug, damit selbst ein Sarg durchfallen kann, zum Beispiel für Don Giovanni. Auch der Orchestergraben ist auffällig unspektakulär. Auf engstem Raum hocken hier bis zu 75 Musiker aufeinander. So heiß und stickig wie bei unserer Tour soll es laut Alex normalerweise nicht sein, doch die Klimaanlage muss penibel genau reguliert werden, damit die Instrumente nicht zu kalt werden. Der Hintern des Dirigenten ist keinen Meter von der ersten Zuschauerreihe entfernt und über den Orchestergraben ist ein Netz gespannt. „Es gab mal einen Zwischenfall mit ein paar Hühnern während einer russischen Oper“, gesteht Alex. Sie seien einfach ins Orchester geflogen. Damit auch die Musiker in der letzten Reihe noch einen Blick auf den Dirigenten werfen können, gibt es Monitore zwischen den Notenständern.



Die ‚Dirigentensuite‘ sieht aus wie das Zimmer in einem Budgethotel, nur der Flügel in der rechten Ecke bringt ein wenig Glanz in die Bude. „Insgesamt haben wir hier 29 Klaviere, die nach Bedarf umgestellt werden.“ Dabei könnten die ‚Gäste‘ im Opernhaus vorab Bescheid geben, was sie bräuchten. „Ein Dirigent bestand darauf, M&Ms zu bekommen, aber keine braunen!“ Das sei eine Strategie gewesen, um die Aufmerksamkeit fürs Detail des Personals zu schulen.
In einem weiteren Gang reihen sich Ankleidekabinen aneinander – wobei der jeweilige Star der Vorstellung am nächsten an der Bühne ist. Die Räume sind wenig größer als Don Giovannis Sarg, und Alex holt uns noch weiter runter auf den Boden der Realität: „Hier stehen die dann in Unterwäsche oder nackig und warten, dass ihnen jemand das passende Kostüm überstreift.“ Das brauchen wir nicht, um an diesem Morgen auf die Bühne zu treten. Da bin ich in Shorts, Socken und einer gelben Sicherheitsweste und will es nicht so richtig glauben: Ich stehe tatsächlich auf einer der berühmtesten Bühnen der Welt. Vor mir der Zuschauerraum mit 2.688 leeren Sitzen, über mir hängt das flexibel anpassbare Dach. Wahnsinn!



Alex erklärt unterdessen, wie die Farbscheinwerfer funktionieren, hält uns ein Buch mit möglichen Filterfarben unter die Nase, die von Hand ausgewählt und eingesetzt werden. „Wir haben hier über 600 Kabelkilometer, an denen mehr als 6000 Lichter hängen!“ Das würde wahrscheinlich für die Stromversorgung einer Kleinstadt reichen. Im Hinterraum stehen Kisten des Sydney Symphony Orchesters, dann führt uns Alex kurz in weitere der fünf Theater, darunter das Drama Theatre und das mit 364 Sitzen kleinste Studio Theatre. Wer im Opernhaus spielen möchte, kann einen Saal mieten, was neben unzähligen Künstlern wie Pavarotti auch Arnold Schwarzenegger 1980 tat, um seinen Mr. Olympia Titel zu empfangen. An die 2.500 Veranstaltungen sollen pro Jahr in allen Theatern des Opernhauses stattfinden und rund vier Millionen Besucher anziehen. Kein Wunder, dass bei so großem Publikum viele Schauspielerinnen erstmal die hölzerne Wand hinter der Bühne küssen, was angeblich Glück bringt. „Das hier ist von Lisa Minelli“, behauptet Alex und wirft einem Lippenpaar einen Luftkuss zu.



Ja, ganz kurz habe ich sie bei diesem Blick hinter die Kulissen erspäht, die Ungeschminkte, die sich morgens aus dem Kissen schält. Und ich mag sie. Verstehe nun die Mühsal und das ständige Bestreben hinter der Perfektion, die das Sydney Opernhaus auf den ersten Blick ausstrahlt. Aber wirklich nur auf den ersten Blick.
Sydney von vorne
Das Beste kommt zum Schluss. Sagt man. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber toll ist es schon. Normalerweise sind die Hotels, in denen ich übernachte so holzklassig wie meine Flüge. Aber einmal im Leben eine Nacht im Park Hyatt Sydney verbringen, einer der exklusivsten Adressen der Stadt, behütet zwischen Opernhaus und Harbour Bridge gelegen, das muss jetzt mal sein. Gut, nicht gleich die Opera Suite für 20.000 AUD die Nacht, eigener Butler inklusive, wo auch schon Elton John ins Kissen sang. Und auch keine Suite für 12.000 AUD. Überhaupt keine Suite, denn selbst ein King Room mit Hafenblick ist unter den 155 Zimmern mehr, als ich mir an edlem Übernachten jemals vorgestellt habe. Alles ist japanisch angehaucht, von den Kunstobjekten bis zu den Schiebetüren, die man zwischen Bett und offene, gläserne Dusche ziehen kann. Und sogar die ausgeklügelte Toilette mit integriertem Bidet und stets gewärmtem Sitz beschwört die schönsten Japanerinnerungen herauf.






Wer sich am Zimmer sattgesehen hat, fährt hoch zum Rooftop-Pool, wo man nicht einfach nur schwimmt oder in der Sonne brät. Vielmehr bleibt man erst mal mit offenem Mund stehen, denn die Harbour Bridge schräg darüber scheint so nahe, dass man sie mit den Fingerspitzen berühren möchte. Eigentlich mag ich keine gechlorten Pools, aber unter der Sydney Harbour Bridge baden ist natürlich etwas ganz anderes.

Für 17 Uhr sind ‚Amenities‘ angekündigt, Höflichkeiten, bei denen ich mir nicht richtig vorstellen kann, was das sein soll. Bis ich nach meiner Rückkehr vom Pool eine Flasche gekühlten Champagners und dazu köstliche Käsestückchen und Knäckebrot vorfinde. Der Moment ist gekommen, frisch geduscht im dicken weißen Bademantel mit Champagner und Käse auf dem Balkon mit gläserner Brüstung zu sitzen. Soeben holt ein Kreuzfahrtschiff die Leinen rein, macht sich bereit für die Fahrt raus auf den Ozean. Ein letztes Tuten aus vollem Horn zum Abschied. Die Harbour Bridge liegt in meinem Rücken, das Opernhaus blitzt um die Ecke auf und ich sehe die Hafen-Skyline vor mir wie auf einem riesigen TV-Bildschirm. Und selbst mit noch champagnerungetrübtem Blick weiß ich es – ich mag es, dieses Sydney, das noch Tausende von weiteren Seiten verbirgt.



Tipp zum Schluss:
Das Park Hyatt würde doch das Reisebudget sprengen? Kein Problem! Als wunderbare und sehr viel günstigere Alternative empfehle ich das YHA Sydney Harbour, das neben Dorms auch geräumige Einzel- und Doppelzimmer bietet. Das Beste aber: Das YHA befindet sich über archäologischen Ausgrabungen, die noch dem kolonialen Sydney entstammen und teils am Eingang zu sehen sind. Und natürlich die große Dachterrasse, die einen der besten Blicke auf den Sonnenaufgang direkt hinterm Opernhaus gibt. Da lohnt sich frühes Aufstehen!


Die Reise nach Australien wurde freundlicherweise unterstützt von Tourism Australia.
Fotos 17, 22, 25, 26, 27, 28 und 29 wurden von Bridge Climb Sydney zur Verfügung gestellt, Foto 48 von Park Hyatt Sydney.









Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!